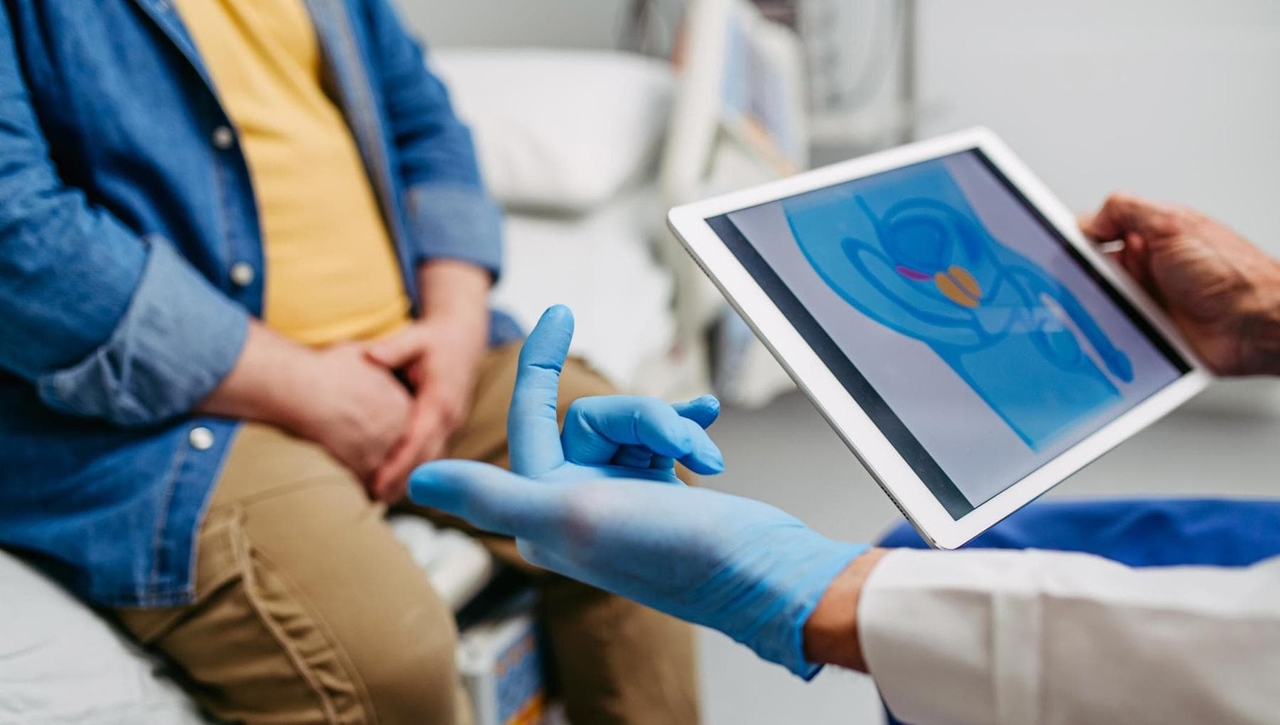Gesundheitsentwicklungen: Il Foglio hat Recht. Schillaci schreibt.


LaPresse
Gesundheitsversorgung ernst genommen
Die Auswahl soll auf Kompetenzen basieren, die Mittel effizienter eingesetzt und lokale Demagogie eingedämmt werden. So erläutert der Minister seine Gesundheitsstrategie.
Zum selben Thema:
Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau Redakteur/in, vielen Dank für Ihren Artikel über die 23.500 italienischen Hundertjährigen , der uns daran erinnert, dass es auch dann gute Nachrichten gibt, wenn allgemeine Katastrophenszenarien sie zu verschleiern suchen. Diese Zahl des italienischen Statistikamtes (ISTAT) ist ein Schlag gegen den professionellen Pessimismus. Und sie ist auch ein perfektes Beispiel dafür, was in der Debatte um das italienische Gesundheitssystem fehlt. Das Schlüsselwort lautet: Ernsthaftigkeit. Die Zahl der Hundertjährigen, die sich seit 2009 verdoppelt hat – ein Anstieg um 130 Prozent in 16 Jahren –, zeigt uns, dass unser staatliches Gesundheitssystem trotz allem funktioniert. Nicht perfekt, nicht einheitlich, aber es funktioniert. Es garantiert eine der höchsten Lebenserwartungen in Europa. Und intellektuelle Ehrlichkeit würde uns gebieten, von dieser Realität auszugehen, nicht um uns selbst zu entlasten oder die Probleme zu leugnen, sondern um zu verstehen, was wir aufgebaut haben und wie wir es bewahren können, während wir gleichzeitig nach Verbesserungen streben. Sie erwähnen drei Punkte – effizientere Mittelverwendung, Auswahl auf Basis von Expertise, Bekämpfung territorialer Demagogie –, die allesamt Beispiele dafür sind, was ich mit Strenge und Verantwortung meine. Ernsthaftigkeit bedeutet, Probleme anzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Volle Verantwortung. Denn niemand kann den ersten Stein auf das überlastete staatliche Gesundheitssystem werfen.
Das Gesundheitssystem ist in 20 regionale Systeme ohne wirkliche nationale Führung zersplittert, seit über einem Jahrzehnt chronisch unterfinanziert und sich planlos entwickelt. Das Ergebnis? Hier Exzellenz, dort Desaster. Und wer das Pech hatte, im falschen Teil der Welt geboren zu sein, spielte dabei keine Rolle. Doch das können wir nicht länger hinnehmen: Ein Bürger darf nicht mit seiner Gesundheit dafür bezahlen, in Apulien statt in Venetien geboren zu sein. Ernsthaftigkeit bedeutet anzuerkennen, dass gute Praktiken nicht politisch motiviert sind. Dass organisatorische Angemessenheit unabhängig von der jeweiligen Regierung funktioniert. Patriotismus – ein starkes und notwendiges Wort – verlangt von uns, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um überall Exzellenz zu erreichen. Wenn ein Neapolitaner in einen Zug steigt, um sich in Brescia oder Padua operieren zu lassen, geht es nicht um Mobilität im Gesundheitswesen. Es ist die Niederlage einer ganzen Nation. Es ist das Eingeständnis, dass der Staat die Gewährleistung gleicher Rechte aufgegeben hat. Sie sagen: Wählen Sie nach Expertise, nicht nach Zugehörigkeit. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich möchte jedoch hinzufügen: Leistungsdaten zu manipulieren, um Parameter und Boni zu sichern, Statistiken zu verfälschen, um Jahresendboni zu erhalten, während Bürger monatelang auf einen Onkologietermin warten müssen, ist nicht nur beschämend, sondern unmenschlich. Und selbst heute noch müssen wir viel zu viele Verantwortliche daran erinnern, dass dies inakzeptabel ist. Ernsthaftigkeit bedeutet, die Dinge beim Namen zu nennen. Die Regierung Meloni hat diesbezüglich von Anfang an einen klaren und konsequenten Ansatz verfolgt.
Die Verordnung zu Wartezeiten ist seit über einem Jahr in Kraft. Und diejenigen, die sie tatsächlich umsetzen, bewirken eine Trendwende: Über tausend Krankenhäuser haben ihre Leistung um 20 Prozent gesteigert. Der Text legt klar fest, wer was zu tun hat und definiert präzise Regeln. Denn wenn einem Bürger gesagt wird, die Wartelisten seien geschlossen, aber nach Zahlung des entsprechenden Betrags plötzlich Ärzte, Ausrüstung und öffentliche Operationssäle verfügbar sind, müssen wir dieses Phänomen beim Namen nennen: illegal, unehrlich und unwürdig. Es handelt sich um fahrlässige Unordnung auf Kosten der Rechte der Schwächsten. Doch es gibt eine Verantwortung, die ich als Arzt – noch vor meiner Rolle als Minister – direkt infrage stelle: die Verantwortung derer, die einen Eid zur Fürsorge für die Menschen geschworen haben. Menschen in Not abzuweisen, um Platz für diejenigen zu schaffen, die zahlen können, ist nicht nur unethisch, sondern verrät den Grund, warum man diesen Beruf wählt. Ich bin seit dreißig Jahren Arzt, habe in Krankenhäusern gearbeitet und weiß, was das bedeutet. Wenn man den weißen Kittel anzieht, darf die erste Frage nicht lauten: „Wie viel Geld haben Sie in der Tasche?“, sondern: „Was brauchen Sie?“ Das Recht auf Gesundheitsversorgung darf nicht von der Zahlungsfähigkeit abhängen. Wenn wir dieses Prinzip akzeptieren, wenn wir es als normal hinnehmen, haben wir bereits alles verloren. Wir haben nicht nur den Pakt mit den Bürgern, sondern auch uns selbst verraten.
Sie haben Recht, wenn Sie schreiben, dass wir 50 Milliarden für nutzlose Tests und unnötige Medikamente verschwenden. Fünfzig Milliarden. Das zuzugeben ist unangenehm, weil es Partikularinteressen, das Machtgleichgewicht und diejenigen betrifft, die von Krankheiten profitieren. Es ist einfacher zu sagen, es fehle immer nur am Geld. Natürlich werden mehr Ressourcen benötigt. Aber wenn diese dann verschwendet, ungenutzt bleiben oder zur Deckung von Haushaltslücken umgeleitet werden – und die Daten des Rechnungshofs über ungenutzte regionale Mittel belegen dies –, was bringt das dann? Sie weisen darauf hin, dass 91 Prozent der Hundertjährigen bei ihren Familien leben, nicht in Einrichtungen. Das ist eine entscheidende Beobachtung. Sie zeigt uns, wohin die Reise im Gesundheitswesen geht. Das ist die wahre Revolution, die uns erwartet und an der wir arbeiten: gemeindenahe Gesundheitsversorgung, gemeindenahe Medizin, integrierte häusliche Pflege. Nicht kathedralenartige Krankenhäuser an jeder Ecke der Stadt, um Wähler zu besänftigen und Bänder durchzuschneiden. Sondern flächendeckende Einrichtungen in der gesamten Region, Telemedizin und Teams, die die Menschen zu Hause besuchen. Insbesondere ältere, gebrechliche und mobilitätseingeschränkte Menschen. Ernsthaftigkeit bedeutet auch, den Mut zu haben, überflüssige Abteilungen zu schließen, bedürftige Pflegeheime zu eröffnen und in Technologien für die häusliche Pflege zu investieren. Eine unbequeme Betrachtung des Verhältnisses zwischen Gesundheitswesen und Konsens. Denn Versprechen sind leicht, Versprechen schwer zu halten.
Es ist leicht, die Schuldigen zu benennen, schwer, Verantwortung zu übernehmen. Es ist leicht, weitreichende Reformen anzukündigen, aber schwer, sie tatsächlich umzusetzen. Unser Ansatz ist anders: Wir konzentrieren uns auf überprüfbare Zahlen, objektive Daten und gezielte Kontrollen. Nicht auf Kontroversen. Nicht auf Schlagzeilen. Wir suchen nach konkreten, nachhaltigen Lösungen, und das braucht naturgemäß Zeit. Der Punkt ist: Ernsthaftigkeit lässt sich nicht finanzieren. Es gibt kein Haushaltsgesetz, das sie bereitstellen könnte, sie lässt sich nicht mit Milliarden aus dem Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (NRRP) erkaufen. Sie ist eine kulturelle Voraussetzung, eine Denkweise, eine ethische Entscheidung, noch vor einer politischen. Es bedeutet, Probleme so zu sehen, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Sie schreiben, und ich stimme Ihnen zu, dass das nationale Gesundheitssystem stärker ist, wenn wir es nicht als Problem betrachten, das es zu beseitigen gilt, sondern als Teil der allgemeinen Stabilität eines Landes. Italiens 23.500 Hundertjährige beweisen dies jeden Tag. Um es aber noch weiter zu stärken, um es weitere fünfzig Jahre bestehen zu lassen, um es künftigen Generationen zumindest so zu hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben, brauchen wir etwas, das keine Finanzmaßnahme jemals bereitstellen kann.
Wir brauchen Strenge. Bei der Problemanalyse, bei der Lösungsfindung, bei der geduldigen Umsetzung von Reformen. Wir brauchen intellektuelle Ehrlichkeit, um zu erkennen, was funktioniert und was nicht, unabhängig davon, wer es bewirkt hat. Wir brauchen Verantwortungsbewusstsein, um gegebenenfalls schwierige und unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ohne all das können wir so viele Milliarden ausgeben, wie wir wollen, wir können die schönsten Reformen der Welt aufs Papier bringen. Aber nichts wird sich ändern. Gute Nachrichten kommen, wie Sie sagen, nie von allein. Um sie häufiger zu erhalten, um sie zu vermehren, müssen wir sie uns verdienen. Mit Ernsthaftigkeit. Mit Strenge. Mit Verantwortungsbewusstsein. Mit Respekt.
Orazio Schillaci, Gesundheitsminister
Mehr zu diesen Themen:
ilmanifesto