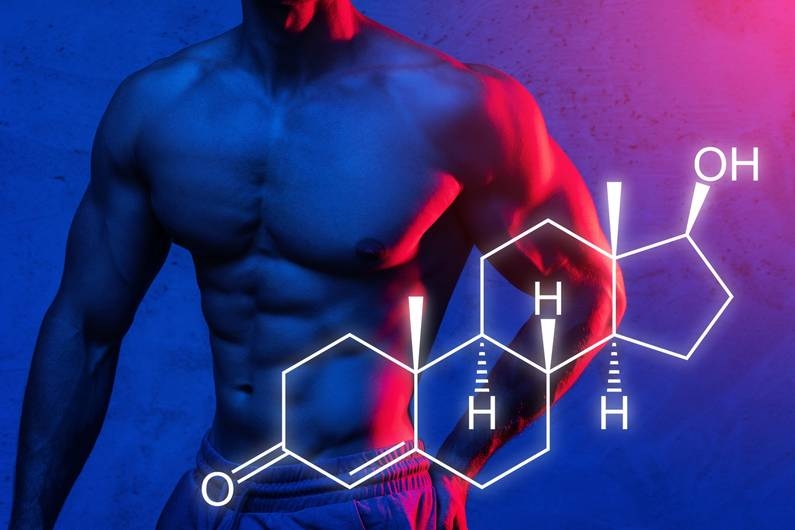Je höher die Bildung, desto mehr Alkohol – Neue RKI-Studie sorgt für Aufsehen

Eine neue Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) beleuchtet den Alkoholkonsum in Deutschland und zeigt deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsgruppen. Ernährungswissenschaftler Uwe Knop erklärt, warum höhere Bildung mit einem höheren Alkoholkonsum korreliert und warum daraus keine direkten kausalen Schlüsse gezogen werden können.
In der neuen Studie zur "Neubewertung des Alkoholkonsums in Deutschland" widmet sich das Robert Koch.Institut (RKI) dem Konsum in unterschiedichen Bevölkerungsgruppen. Grundsätzlich konsumiere ein Drittel der Menschen in Deutschland Alkohol in gesundheitsschädlichen Mengen.
Als Abstinenzler, also Menschen, die gar keinen Alkohol trinken, sehen sich 21,2 Prozent in Deutschland, konkret 16,7 Prozent der Männer und 25,3 Prozent der Frauen.Das Interessantes Ergebnis des RKI ist jedoch der deutlich unterschiedliche Alkoholkonsum in den gesellschaftlichen Schichten.
Uwe Knop ist Diplom-Ernährungswissenschaftler, Buchautor, und Referent für Vorträge bei Fachverbänden, Unternehmen und auf Ärztefortbildungen. Er ist Teil unseres EXPERTS Circle. Die Inhalte stellen seine persönliche Auffassung auf Basis seiner individuellen Expertise dar.
Je höher die Bildungsgruppe, desto mehr Alkohol wird getrunken! Während in der hohen Bildungsgruppe fast 55 Prozent der Männer und 33 Prozent der Frauen ein Trinkverhalten mit moderatem oder hohem Gesundheitsrisiko zeigen, so, sind es in der niedrigen Bildungsgruppe 38 Prozent der Männer und etwa 13 Prozent der Frauen. Die Bevölkerungsgruppe mit dem niedrigsten Risiko-Konsum ist diejenige mit niedrigem Bildungsgrad.
Nein, diese Aussage ist falsch und irreführend. Obwohl die Statistik zeigt, dass in der Gruppe mit dem höchsten Bildungsniveau auch der höchste Anteil an Personen mit risikoreichem Alkoholkonsum zu finden ist , bedeutet das nicht automatisch, dass Alkohol zum Erfolg führt.
Diese Beobachtung ist eine reine Korrelation (ein gleichzeitiges Auftreten zweier Faktoren), nicht aber eine Kausalität (Ursache und Wirkung). Der „Erfolg“ (hier Bildung) ist eher ein Indikator für andere Faktoren wie höheres Einkommen, soziale Anlässe, oder einen bestimmten Lebensstil, die den Alkoholkonsum wahrscheinlicher machen.
Man kann keine Kausalität schließen, weil eine Korrelation (A tritt zusammen mit B auf) nicht beweist, dass A die Ursache für B ist (Kausalität). Es könnten viele weitere Faktoren oder auch nur ein einziger dritter unbekannter, nicht analysierter Faktor (C) dahinterstecken, der sowohl A als auch B beeinflusst (das nennt man "Confounder"):
Beispiel Alkoholkonsum: Die Korrelation "Hohe Bildung → Hoher Alkoholkonsum" liegt wahrscheinlich am Faktor C: Sozioökonomischer Status/Netzwerk. Gebildete Menschen haben oft ein höheres Einkommen und nehmen an mehr sozialen Veranstaltungen teil (Networking, Geschäftsessen), was den Alkoholkonsum erhöht.
Beispiel aus der Ernährungswissenschaft (Klassiker): Die Korrelation "Kaffeetrinker → Höhere Rate an Herzerkrankungen" in älteren Studien führte fälschlicherweise zur Annahme, Kaffee sei schädlich. Der verborgene Faktor C war jedoch das Rauchen. Früher rauchten Kaffeetrinker häufiger. Das Rauchen war die wahre Ursache für die Herzkrankheiten, nicht der Kaffee.
Diese "Umdeutung" von Korrelationen zu Kausalitäten ist das Grundproblem der Ernährungskommunikation - denn hier gibt es keine Kausalevidenz, weil dieser bemitleidenswerte Forschungszweig unter so vielen Limitierungen leidet, dass Ernährungswissenschaft dem Lesen einer Glaskugel gleicht. Daher wird gerne "so getan", als kenne man die kausale Wahrheit - einfach, um wichtig zu bleiben und die Deutungshoheit zu bewahren. In Wahrheit aber tappen die Ernährungsforscher im rabenschwarzen Dunkeln!
Die aktuelle RKI-Studie liefert keine direkten kausalen Gründe, aber die Ergebnisse deuten auf soziale und strukturelle Erklärungen hin, die mit dem höheren Bildungsgrad verbunden sind. Gebildete Menschen trinken vermutlich viel mehr Alkohol aufgrund folgender Faktoren;:
Höhere soziale Akzeptanz: Alkoholkonsum in Form von Wein bei Geschäftsessen, Aperitifs oder Networking-Events ist in diesen Kreisen oft kulturell und sozial stark etabliert und akzeptiert.
Höheres Einkommen und Verfügbarkeit: Ein höheres Einkommen ermöglicht den Kauf von teureren alkoholischen Getränken (auch als Statussymbol) und die Teilnahme an Anlässen, bei denen (teurer) Alkohol üblich ist.
Wahrgenommenes Risiko: Es wird vermutet, dass diese Gruppen ihr eigenes Risiko im Vergleich zu anderen Gruppen tendenziell unterschätzen oder glauben, durch ihren gesunden Lebensstil (z. B. Sport) die Risiken ausgleichen zu können. (Dies ist eine gängige Erklärung, die oft in Studien zu Bildung und Gesundheitsverhalten diskutiert wird.)
Denn auch hier gibt es, wenn überhaupt, nur Korrelationen - und die zeigen in aktuellen Studien wieder ganz klar in die vermutlich "schützende Richtung".
Klar ist aber auch: Alkohol in dauerhaft hohen Mengen kann zur Sucht und enormen Problemen führen, besonders, wenn man zum Alkoholiker wird. Aber das ist ein Thema für sich.

Bildquelle: Uwe Knop
Buchempfehlung (Anzeige)
"ENDLICH RICHTIG ESSEN" Mit gutem Gewissen ehrlich genießen - Vertraue auf Deine ETHIK & INTUITION von Uwe Knop
FOCUS